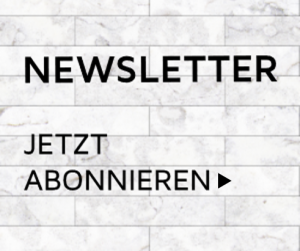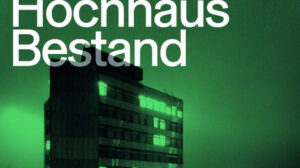Die Wiederverwendung gebrauchter Bauteile führt zu einem vielstimmigen, collagenhaften Ausdruck. Die neue Architektursprache verändert unseren Blick auf die gebaute Umwelt. Das ist irritierend, aber zugleich reizvolles gestalterisches Neuland.
Autor Amandus Samsøe Sattler
Orangefarbene Trapezblechverkleidung, irritierende Proportionen, stilistischer Bruch zwischen Bausubstanz und Dachaufbau: Das K118 in Winterthur ist
Lesen Sie weiter mit mdPlus.
Registrieren Sie sich und genießen Sie exklusive Vorteile
+ Wöchentlich neue mdPlus-Beiträge
+ Beitragsarchiv mit über 500 mdPlus-Artikeln
+ Ausgewählte Video-Fachvorträge
+ Alle Hefte als PDF pünktlich zum Erscheinungstermin
+ 4 Wochen kostenlos, danach 7,50 Euro pro Monat
+ Monatlich kündbar
Sie sind bereits mdPlus-Abonnent?
Hier anmelden»
Sie sind bereits md-Printabonnent?
Hier upgraden»





 Zirkuläre Ästhetik
Zirkuläre Ästhetik