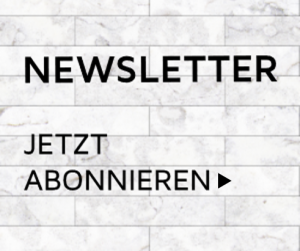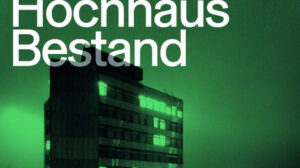Wenn Handwerkstechniken in Vergessenheit geraten, verschwindet auch Wissen über nachhaltige Materialien und nachwachsende Ressourcen. Doch manche Designer steuern gegen.
Autorin Diana Drewes
Immer mehr traditionelles Handwerk gerät in Vergessenheit: Eine Entwicklung, die im Zeitalter von industrieller Massenproduktion, schwimmenden Müllinseln in den Ozeanen und „Fridays for
Lesen Sie weiter mit mdPlus.
Registrieren Sie sich und genießen Sie exklusive Vorteile
+ Wöchentlich neue mdPlus-Beiträge
+ Beitragsarchiv mit über 500 mdPlus-Artikeln
+ Ausgewählte Video-Fachvorträge
+ Alle Hefte als PDF pünktlich zum Erscheinungstermin
+ 4 Wochen kostenlos, danach 7,50 Euro pro Monat
+ Monatlich kündbar
Sie sind bereits mdPlus-Abonnent?
Hier anmelden»
Sie sind bereits md-Printabonnent?
Hier upgraden»
Mehr zum Thema Akustik mit Sidebar





 Zeit der Rückbesinnung
Zeit der Rückbesinnung