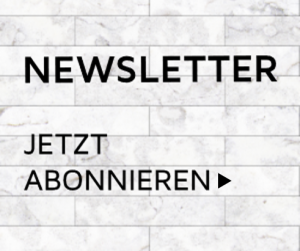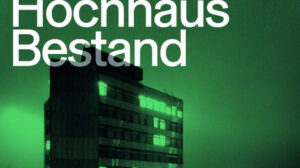Das Designstudio Formafantasma weiß mit seinen Materialexperimenten Aufmerksamkeit zu erregen, erst mit Gefäßen aus Getreide und Spinat, jetzt mit Büromöbeln aus Elektroschrott. Das multimediale Projekt ‚Ore Streams‘ reflektiert den verantwortungsvollen Umgang mit endlichen Ressourcen.
Autorin: Johanna Neves Pimenta
Ausstellung ab 20. März in der Serpentine
Lesen Sie weiter mit mdPlus.
Registrieren Sie sich und genießen Sie exklusive Vorteile
+ Wöchentlich neue mdPlus-Beiträge
+ Beitragsarchiv mit über 500 mdPlus-Artikeln
+ Ausgewählte Video-Fachvorträge
+ Alle Hefte als PDF pünktlich zum Erscheinungstermin
+ 4 Wochen kostenlos, danach 7,50 Euro pro Monat
+ Monatlich kündbar
Sie sind bereits mdPlus-Abonnent?
Hier anmelden»
Sie sind bereits md-Printabonnent?
Hier upgraden»
Mehr zum Thema Nachhaltigkeit





 Hidden Treasures
Hidden Treasures