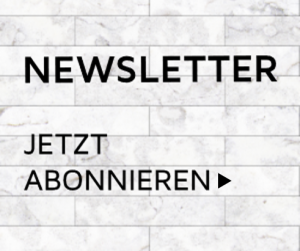Räume im Krankenhaus sollen die Heilung unterstützen und nicht krank machen. Besonders Patienten in der Regelleistung wird viel zu oft ein Umfeld zugemutet, das nüchtern und lieblos wirkt. Innenarchitektin Sylvia Leydecker will das ändern.
Autorin Sylvia Leydecker
Ein gut gemachtes Healing Environment mindert den Stress
Lesen Sie weiter mit mdPlus.
Registrieren Sie sich und genießen Sie exklusive Vorteile
+ Wöchentlich neue mdPlus-Beiträge
+ Beitragsarchiv mit über 500 mdPlus-Artikeln
+ Ausgewählte Video-Fachvorträge
+ Alle Hefte als PDF pünktlich zum Erscheinungstermin
+ 4 Wochen kostenlos, danach 7,50 Euro pro Monat
+ Monatlich kündbar
Sie sind bereits mdPlus-Abonnent?
Hier anmelden»
Sie sind bereits md-Printabonnent?
Hier upgraden»





 Healing Beauty
Healing Beauty