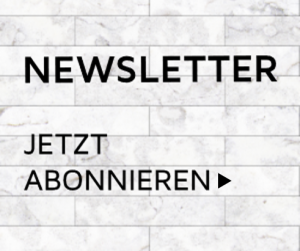„Das ganze Unglück der Menschen“ rühre daher, behauptete einst Blaise Pascal, „dass sie nicht ruhig in einem Zimmer bleiben können.“ Nun vermieten sie ihre Zimmer an andere, die das auch nicht können. Das Ergebnis: Airbnb!
Autor Thomas Edelmann
Immer häufiger tauchen Touristen mit Rollkoffern und spezifischen
Lesen Sie weiter mit mdPlus.
Registrieren Sie sich und genießen Sie exklusive Vorteile
+ Wöchentlich neue mdPlus-Beiträge
+ Beitragsarchiv mit über 500 mdPlus-Artikeln
+ Ausgewählte Video-Fachvorträge
+ Alle Hefte als PDF pünktlich zum Erscheinungstermin
+ 4 Wochen kostenlos, danach 7,50 Euro pro Monat
+ Monatlich kündbar
Sie sind bereits mdPlus-Abonnent?
Hier anmelden»
Sie sind bereits md-Printabonnent?
Hier upgraden»





 Segen oder Fluch?
Segen oder Fluch?