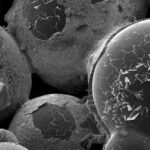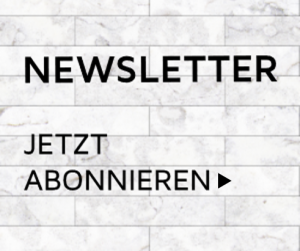Längst fragen Kunden nicht mehr nur nach dem Preis bei der Wahl eines neuen Bodenbelags. Sie erwarten kreislauffähige Werkstoffe, nachhaltige Produkte. Da gibt es mittlerweile unterschiedliche Ansätze und Materialentwicklungen: eine Übersicht.
Bei der Auswahl neuer Bodenbeläge fordert der Kunde mittlerweile konsequente Nachhaltigkeit ein — so wie
Lesen Sie weiter mit mdPlus.
Registrieren Sie sich und genießen Sie exklusive Vorteile
+ Wöchentlich neue mdPlus-Beiträge
+ Beitragsarchiv mit über 500 mdPlus-Artikeln
+ Ausgewählte Video-Fachvorträge
+ Alle Hefte als PDF pünktlich zum Erscheinungstermin
+ 4 Wochen kostenlos, danach 7,50 Euro pro Monat
+ Monatlich kündbar
Sie sind bereits mdPlus-Abonnent?
Hier anmelden»
Sie sind bereits md-Printabonnent?
Hier upgraden»





 Unsichtbarer Fußabdruck
Unsichtbarer Fußabdruck